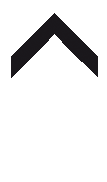Rainer Beßling
Variation und Differenz
Wenige Pinselstriche markieren eine Fläche und öffnen den Raum. Farbbahnen verlieren sich im Ausschwung der Bewegung, andere weisen im Anschnitt über die Leinwand hinaus. Der Bildraum ist unbegrenzt und frei von Figur. Was ihn erfüllt, sind Bewegung und Gewebe. Ein Gespinst aus Licht und Dunkel, Klarheit und Dunst, Vitalität und Schleier.
Horizontale und vertikale Züge geben dem Geschehen Halt und dehnen es aus. Kreuz und Winkel sind hier Anker und Anschub zugleich. Sie verleihen Statik und verlangen nach Ausbruch. Sie sind Quelle und Gegenpol von Dynamik in einer Momentaufnahme, die Dauer behauptet. Lasierende Schwünge stellen sich quer, duftige Farbbäusche blühen aus den Achsen. So schweben auch feste Formen, und dunklere Felder öffnen sich. Die Fläche zeigt ihren Rück- und einen Echoraum, die Linie ihren Ursprung und Verlauf.
Zu den linearen Koordinaten treten Korrespondenzen und Kontraste in der Tiefe. Die gegenläufige Dynamik der Strichführung verschlingt sich mit der Schichtung der Flächen. Ebenen entschwinden und scheinen durch, rücken näher und entfernen sich. Das Bildgeschehen pendelt zwischen Verdichtung und Entfaltung. In der Abwesenheit figürlicher Protagonisten, ausgewiesener Abstraktionen oder stürmischer Gesten offenbart sich das Bild in seinen elementaren Ereignissen. Die Wahrnehmung verharrt beim vorbegrifflichen sinnlichen Impuls und kommt damit zu sich selbst.
Wie lässt sich bezeichnen, was Achim Bertenburgs Malerei verströmt? Mancher Betrachter könnte sich an das Informel erinnert fühlen. Jedoch - die Linie als umgestülpte Innerlichkeit, die Entfernung von einer mit Geschichtslast beladenen Figur als Annäherung zu einem neuen Ich? Selbstgenügsame Bildpoesie als Neustart und Insel? Bertenburgs Bilder prägt eine andere Entäußerung. Seine lyrischen Formeln sind prosaisch geerdet. Seine Arabesken beschwören weder Ferne noch Flucht, sondern markieren Wege im Hier und Jetzt. Die kalligraphisch anmutenden Schwünge bauen keinen meditativen Zierrat auf, sondern Zeichenwirbel zwischen Zugriff und Loslassen, Auflösung und Verklammerung.
Manche könnten in den Bildern expressive Gestik lesen. Doch in dieser Malerei findet nicht spontaner Ausdrucksdrang seinen Niederschlag. Genauso wenig gibt sich eine Écriture zu erkennen, die im Spontanvollzug Kontrolle auszuschalten und psychische Einlagerungen bildhaft dingfest zu machen versuchte. Bertenburg sucht und setzt, mal mehr, mal weniger erkennbar, ein Format. Einige Bilder beginnen mit einer regelhaften Punktformation oder geometrischen Grundordnung. Bisweilen bleiben solche Gitter und Raster durchgehend präsent, halten bei allen linearen Ausgriffen und Bündelungen, Verwischungen und Nebelbildungen die Stellung. Oft werden sie gänzlich übermalt, hindern den Künstler aber noch untergründig am bodenlosen Fabulieren. Manches Bild beginnt auch mit einer Figuration.
Am Ende schimmert sie allenfalls schemenhaft in der Tiefe und Ferne durch, wird als Werkgerüst zurückgebaut, von den malerischen Folgeereignissen verdeckt oder nimmt als Malgrund eine Stimme im Farbakkord ein. Funken schlägt der freie Strich erst in der Reibung an der festen Form.
In einer Komposition scheint ein solches Funkensprühen auf der Basis eines Punktrasters Taktgeber und Motiv: ein monochromes Feuerwerk der Farbe, freier Flug und doch gebändigt, eine Choreographie der Fliehkräfte mit Kontakt zur Basis, Synapsen in rätselhafter Schaltung oder auch die unterirdische Ausdehnung eines Rhizoms, durch einen Glasboden betrachtet. Abstrakter aufgefasst: ein geheimnisvolles System in Aktion, zur Anschauung gebracht durch das Kontrastmittel Kunst.
Die Tempi variieren, die dynamische Palette ist breit. Raschere Zugriffe stehen neben bedachtsamer Entwicklung und Entfaltung, leisere neben lauteren Stellen. Nicht vorrangig schnelle Pointen, sondern Prozess und Polarität prägen das Bild. Das Gesamtereignis ist immer im Blick, doch auch kleinste Lineaturen übernehmen tragende Rollen. Nebenstrecken orchestrieren die Hauptpfade und geben erst den Klang.
Bestimmte Zentren und Schichten zu fokussieren, Akteure oder Zeichen dingfest zu machen, fällt in dieser Malerei schwer. Greifbar zu sein scheint nur, was sich am schwersten fassen lässt und eine Vokabel nahelegt, die im Verdacht des unverbindlichen Platzhalters bei begrifflicher Ratlosigkeit steht: Atmosphäre. Bertenburgs Malerei scheint zu behaupten, dass das, was sich der Beschreibung entzieht, den Dingen, Orten, Räumen und Beziehungen ebenso wesentlich ist wie begrifflich fixierbare Eigenschaft.
Wörter wie Aura oder Anmutung verlieren im Angesicht dieser Werke den Charakter einer spekulativen Erfindung und offenbaren eigene Substanz als Fundsache der Sinne. Was schon die Wirklichkeit dem empfänglichen Auge bietet, baut das Kunstwerk in einer Mischung aus planvoller Inszenierung und Intuition: Die Atmosphäre von Räumen, die durch Kommunikation belebt sind. Die Begegnung von Werk und Betrachter ist zugleich Inhalt des Bildes. Dialog ist Strukturprinzip und Inhalt dieser Malerei.
Dass viele Bilder an Landschaften denken lassen, ist kein Zufall. Der reale Landschaftsraum als Ensemble von Natur- und Kulturelementen vermittelt neben topographischer Eigenart und geographischer Beschaffenheit Atmosphäre. In der Wahrnehmung löst sie spezifische Gestimmtheit aus. Bertenburg bildet keine Landschaften ab, er lässt in seinen Bildern sprechen, was aus der Landschaft nach außen tritt und was Betrachter an Projektion hinein tragen. Seine Malerei mit ihrer eigenen topographischen Wirklichkeit ist von Landschaftserinnerungen getränkt und spielt mit dem Gleichklang, den Bild und Wirklichkeit anstimmen.
Manche Fotografien Bertenburgs - teilweise dienen sie als Werkimpuls - tragen diesen atmosphärischen Gehalt des Landschaftsblicks in sich. Ein Flusslauf in sanftem Schwung, Vordergrund und Achse, die den Augenblick dynamisiert, den Raum weitet und die Augen abschweifen lässt. Bäume und
Wolken spiegeln sich in der Wasseroberfläche, die Schwelle und Abschluss ist, sichtbar als Projektionsfläche fungiert und Projektion in Bild und Gedanke zum Thema macht. Eine Architektur mit klassizistischen Säulenreihen um Ufer repräsentiert Konstrukt und Kultur. Spuren menschlicher Präsenz in Harmonie mit der Natur? Relikte einer vergangenen, wohlmöglich idealisierten Epoche? Die Ruine als Nachhall verlorener Proportionalität und Ordnung? Bald klären sich im Dunst der Projektionen aufschlussreiche Details. Das Ufer ist von Müll übersät, die Pfeiler tragen eine Straße im Bau. Die Wirklichkeit bricht sich an der Wahrnehmung.
Das Foto kann als Beispiel dienen: So wie sich der Begriff „Atmosphäre“ für die Bildwelt Bertenburgs anbietet, liegt auch „Romantik“ nicht fern. Die Vokabel wirkt belastet und scheint für die Kunstproduktion der Gegenwart ein Tabu zu sein. Dabei ist eines der Phänomene, das sie benennt, der treueste Begleiter der Moderne, und je länger diese andauert, je mehr Erfahrung das frei gesetzte und suchende Ich mit der Welt und mit sich selbst gemacht hat, desto schwerer wird das Gepäck des Wanderers, desto weiter und undeutlicher die Ziele und desto komplexer die Wege.
In der Konfrontation mit dem eigenen Inneren musste der Mensch dem Dauerprojekt der Aufklärung die permanente Erkundung seiner Empfindungswelt zur Seite stellen. Erhellende und klärende Vernunft lernte ihre Grenzen in schwer beherrschbaren Trieben und hilfreichen Instinkten kennen. Der romantische Blick ist ein dauerhaft gebrochener, die Utopie trägt schwer an ihrer eigenen Historie. Der Mensch ist in der
Freisetzung aus Fremdbestimmung und hausgemachter Unmündigkeit den neuen Welten und sich selbst fremd geworden.
Zur Romantik gehört der Aufbruch in die Natur und die Suche nach den Ursprüngen, Bindungen, gesetzten Ordnungen und eigenen Orten. Zu ihr gehört auch der Glaube in die Kunst als Katalysator und Chronik dieser Wanderung, als geschützter und schonungsloser Übungsraum für die Wege durch die Welt. Achim Bertenburgs künstlerische Existenz und seine Malerei bezeugen eine individuelle Spielart dieses Unterwegsseins.
Die Raster als Initialzündung seiner Malerei stehen für eine Ordnung, die den Aufbruch verankert und motiviert. Die Strichführung markiert die Suchbewegung im Vor und Zurück, in ihren Stationen und Kreuzungen. Spuren und Navigationspläne überlagern sich, Malschichten beschreiben verschiedene Klimaverhältnisse und Ortscharaktere, Farbdichten sprechen von Klärung oder Trübung des Fühlens und Denkens. Die Kompositionen zeichnen Naturansicht oder -erfahrung nicht nach oder vor. Sie entwerfen malerische Parallelprozesse.
Empfindung und Reflexion geraten darin nicht in harmonischen Ausgleich oder friedliche Koexistenz, sondern bauen im Widerstreit Spannung auf. Ob Wege beginnen oder versanden, bleibt offen. Ob Ordnungen am Anfang stehen oder den Bildprozess abschließen, ob der imaginäre Wanderer sein Ziel erreicht hat oder im Labyrinth verbannt bleibt, muss der Betrachter
entscheiden. Atmosphäre ist eine flüchtige Daseinsform mit wechselnden Konsistenzen. Materiell ist nur ihre alles umschließende und den Blick aufsaugende Wirkungsmacht. Wo sich die Dinge entziehen, hält sie Einzug, verdrängt Anschauung und macht anderer sinnlicher Wahrnehmung Platz.
Es gibt Bilder Bertenburgs, in denen Natur in ihren sichtbaren Formationen, in ihrer Stofflichkeit und Struktur aufzutreten scheint. In häufig grün-bläulichem Kolorit, durchzogen von hellen Schlieren, aufgewirbelt wie von Wasserfluss oder Windzug, bieten sich Flächen dar, die fokussierten Landschaftsereignissen nahekommen. Nahsichten und Gesamtschauen, Mikro- und Makrokosmen als Belege gemeinsamer Formgesetze, Schichtung und Schwelle als Verweis auf den organischen Prozess, dem Natur als Einzelereignis und in der Gesamtheit unterliegt.
Doch weit mehr als ihre Ansicht, ist es die Begegnung mit der Natur oder besser die Begegnung mit sich selbst in der Natur, die in Bertenburgs Malerei Ausdruck findet, einen Ausdruck, der das Gesehene und das Sehen selbst hinter sich lässt und den Raum bildlich zu fassen sucht, der zwischen beidem entsteht. In einem nebelverhangenen monochromen Bild mit Schiffs(?)silhouette und einer Rundform, die Kuppel oder Ballon sein könnte, wirkt die Szenerie entrückt und die Figuration nicht greifbar. Die gegenständliche Andeutung ist eine Herausforderung zur Auslegung mit gleichzeitiger Warnung vor der Ausdeutung. Mit der Entschlüsselung ist der Zauber gebrochen. Das Bild hält als Rätsel stand.
Wieder ist es eine Fotografie, die dokumentiert, worauf der Künstler Aufmerksamkeit richtet, und Verständnishilfe leisten könnte. Sie zeigt ein Pferd vor den Holzträgern eines Gebäudes, angebunden, mit einer Decke auf dem Rücken. Vor dem rechten Hinterlauf kniet eine Person, nur schemenhaft erkennbar. Die Dunkelheit taucht die Szene in eine merkwürdige Dämmerstimmung, der Ort ist nicht identifizierbar, im Hintergrund leuchten Lampen auf. Die stillen Bildakteure stehen in einem fahlen Licht, der Betrachter ist auf Distanz gehalten und darf sich als Zaungast eines in sich ruhenden, sich selbst genügenden Geschehens fühlen.
Seinen Nachhall und Niederschlag findet eine solche teilnehmende Beobachtung in einer Malerei, die mehr physisch als stofflich genannt werden kann, die das Erleben über das Erlebte stellt, die Malmaterial und Malwerkzeug bewusst konservativ wählt, weil mit ihnen der Objektbezug in eigener Maßstäblichkeit, in dem vom Körper erreichbaren und beschreibbaren Format möglich ist. Die Entscheidung zur Handarbeit und Handhabbarkeit resultiert aus dem Vertrauen in die Eindringlichkeit und Dauer der haptischen Erfahrung, dem Gegenmittel zur Entfremdung.
Grafische oder flächige Ereignisse auf der Leinwand zeichnen dies nicht nach, evozieren aber verwandte Empfindungen und initiieren eine praktisch-künstlerische Verhandlung über die Wanderbewegungen des eigenen Ich, die Widerstände und Anschübe, Wände und Lichtungen. In der Farbwahl
zeigt sich Sympathie für ein Dunkel, das verdeckt und abschirmt, aber auch auf ein Innenleben schließen lässt, das enthüllt werden will - eine Doppelseite, die das Wechselverhältnis von Heraustreten und Hineintragen stützt, das dieser Malerei ihre Atmosphäre verleiht. Eine häufig gewählte Monochromie bündelt die Aufmerksamkeit für Binnenereignisse, der Gleichklang sensibilisiert für Valeurs, für lineare Dynamik und die Schwellen zwischen den Schichten. Auch mit dem Kontrast von Natürlichkeit und Künstlichkeit spielt der Maler in der Farbentscheidung – etwa wenn allzu grelles Hellblau das satte Grün überstrahlt oder ein Pink hinter den Erdtönen leuchtet.
Achim Bertenburg bleibt in der Wirklichkeit seiner Bilder. Natürlich weiß er um die Veränderung der Fortbewegung, den Verlust von Naturerfahrung und die Beschleunigung der Welt. Er redet keinem Eskapismus das Wort, nimmt am wenigsten sich selbst aus der Gegenwart und stellt auch nicht eigenes Leiden an der selben mit melancholischem Blick in den Rückspiegel auf seine Leinwände. Selbstverständlich weiß er um die Entwicklung der Kunst,
ihren aktuellen Stand und die Macht der Diskursmasse. Doch konzeptueller Zugriff und herkömmliche Technik schließen sich dennoch nicht aus.
Bertenburgs Malerei stößt Dialoge an und protokolliert deren Prozess. Die Strichbündel, Bahnenkreuze und Flächengemenge sind nicht nur Bildparallele zur Bewegung und Selbsterfahrung des Ich in der Natur. Sie sich auch dialektische Verhandlungen im augenfälligen Vollzug über die Malerei in ihren historischen Angeboten und ungebrochen aktuellen Potenzialen, über eine Wirklichkeit, die nach außen tritt, wenn die Wahrnehmung auf ihre Aura diffus gestellt wird, über die Wechselbeziehung von Natur und Kultur, über die Komposition organischer Entfaltung.
Das Anfangsraster steckt den Rahmen ab und fixiert ein Format. Daran knüpfen sich die ersten Motive, die sich zu Themensträngen bündeln. Das grafische Geschehen findet Resonanz und Widerstand in Farbflächen, die sich zu Räumen schichten. Jeder Formation gleicht einer Formulierung, die Nebenstimmen weckt und Gegenstimmen hervorruft. Sind die Wege anfangs noch neu und die Felder frei, tragen die Linien mehr und mehr an ihrer eigenen Geschichte und dem Konzert ihrer Begleiter und Gegenpole.
Kristallisationen verflüssigen sich wieder, Konstellation treiben wieder auseinander. Die Entwicklung verläuft nicht linear, sondern in Schüben, mit Stillständen und Rückschritten, in der Rückschau und im Vorschein ungewissen Neulands. Nicht die neuen, offenen Horizonte und großen Entwürfe werden anvisiert, sondern die Bündelungen der kleinen Bewegungen in unablässiger Variation. Motor ist der Austausch von Wiederholung und Differenz. Daran schärft sich die Wahrnehmung.
Die Erkundung neuer Orte und Entdeckung neuer Konstellationen wird zum Wechselgespräch zwischen Bildgeschehen und Bildentwurf. Die Malerei begegnet sich selbst und bleibt unterwegs im Austausch der Positionen und in der Suche nach einer Ordnung. Jede Bewegung bleibt erkennbar, jede Form präsent. Jede Stimme in jeder Klangfarbe und dynamischen Prägung behauptet ihren Platz in permanentem Fluss und steter Abwägung. Eine Einheit gibt es nicht ungebrochen, jeder malerischen Aktion folgt eine Reflexion, Bewegung und Bedenken in einem.
Achim Bertenburg bindet seine Malerei an körperliche Erfahrung und lädt seine Bilder mit größter Reflexion auf. Er hält den Blick auf die Landschaft und an der Erkundung der Natur fest und lässt doch seine Kompositionen ohne Wirklichkeitsanleihen und Gegenstandsandeutungen sprechen. Auch in seinen Bildern steht das Ich im Zentrum von Suchbewegungen, doch es bleibt unsichtbar, ohne lyrische Stellvertreter oder gestisch-expressive Entladung. Bertenburg schafft mit seiner Kunst eine Atmosphäre, in der der Nachhall dieser Stimmen sich in einer eigenen Qualität zusammenfindet. Je nach Wahrnehmungsperspektive oder Fokussierung nimmt er eine andere Gestalt an. Mit jedem neuen Bild lagert sein Unterwegssein ein neues Kapitel Geschichte an, das die Visionen nicht leichter machen. Mit jedem Schritt erreicht das Wechselspiel von Klärung und Eintrübung eine neue Stufe, und er würde als letzter behaupten, nur in einer Richtung.
Katalogtext Ausstellung Weserburg / Museum für moderne Kunst, 2011
Peter Friese
Über den künstlerischen Umgang mit Ein-Bildungen
Gedanken zu den neueren Arbeiten von Achim Bertenburg
Ein Junge sitzt an einem Tisch und malt. Er tut dies mit einer solchen Hingabe, dass er alles um sich herum, auch die Tatsache, dass er gerade fotografiert wird, zu vergessen scheint. Weil er sich stark nach vorn beugt, kommt sein Kopf beinahe auf dem linken Ellenbogen zu liegen. Die Arme auf dem Tisch bilden dabei eine Art Gehege und der Kopf mit dem konzentriert blickenden Kindergesicht vollendet das Ganze zu einem kleinen Raum im Raum. Augen, Hände und der Gegenstand, der gerade bemalt wird, gelangen auf diese Weise in direkteste Nähe zueinander, verschmelzen zu einer Art Schutzzone der Produktivität und Selbstvergessenheit. Die in sich gekehrte Körperhaltung macht deutlich, dass der Kleine in diesem Moment ganz bei sich, also in seiner eigenen Welt ist und sich für das, was um ihn herum passiert, kaum interessiert. Die Umgebung, der Raum, in dem sich diese private, ja intime Szene abspielt, ist indessen kein Kinderzimmer, sondern das Atelier des Vaters. Rechts sieht man einige Malutensilien auf dem Tisch liegen, Flaschen, welche Leim, Firnis oder Malmittel enthalten, und einige große Farbtuben. Im Hintergrund befinden sich zwei große bemalte Leinwände, von denen die eine wolkenartige Formationen zeigt. Links der Hauptszene gibt es eine Art Leuchtkasten mit mehreren senkrechten Neonröhren darin.
Nun könnte die Alltäglichkeit dieser Situation zum Anlass genommen werden, sie schnell ad acta zu legen und vergessen zu wollen, käme nicht in dieser Haltung, die der kleine Junge äußerlich und innerlich einnimmt, etwas zum Ausdruck, das in mehrfachem Sinne etwas mit Achim Bertenburgs Arbeit zu tun hat. Nicht die Tatsache, dass wir es hier mit einem anrührenden Dokument einer Vater-Sohn Beziehung zu tun haben, ist das Bemerkenswerte, sondern, dass der Ältere angesichts dieses Fotos und anderer Situationen, in denen er sein Kind beobachtet, sich wie von selbst an seine eigene Kindheit zu erinnern beginnt und sich auf einmal in einer seit über 50 Jahren vergangenen kindlichen Traumwelt wieder findet.
Mit anderen Worten: Ihm wird bewusst, dass auch er vor vielen Jahren einmal als kleiner Junge zu ähnlicher Selbstvergessenheit fähig gewesen ist und an einer vergleichbaren Gedanken- und Traumwelt Teil hatte, zu der er nun als Erwachsener keinen direkten Zugang mehr erhält. Dass letztlich eine bei seinem Sohn zu beobachtende übergangslose Einheit von Denken, Träumen, Wahrnehmen und Handeln in der Regel mit dem Erwachsen Werden verloren geht, um schließlich in Vergessenheit zu geraten.
Wenn überhaupt, dann vermag man als Erwachsener nur noch über Umwege, etwa beim Betrachten von alten Bildern, beim Lesen von Briefen und Tagebuchnotizen, aus einer zeitlichen Distanz heraus und begleitet von melancholischen Gefühlen an die vergangene Welt der eigenen Kindheit sich heranzutasten. Und auch dann ist man nur im Sinne kleiner aneinander gereihter Fragmente in der Lage, eine Rest- Ahnung dieses mehr und mehr verhallenden Echos zu erhalten.
Natürlich könnte man hier lakonisch anmerken, dass das Einnehmen einer solchen Haltung nicht nur melancholisch und sentimental, sondern auch vollkommen zwecklos sei, vermag es doch niemals echte Verknüpfungen zwischen dem Damals und dem Jetzt herzustellen. Es ist eben nicht möglich im Sinne einer gedanklichen Zeitmaschinen-Operation noch einmal genau dort anzusetzen, wo man als Kind tatsächlich einmal war. Nach kurzer Zeit wird einem klar, dass selbst mit Macht wieder auftauchende längst vergessen geglaubte Gedanken und Gefühle „von damals“ nicht mehr richtig zum inzwischen veränderten Selbst und dessen entzauberter Gegenwart passen wollen. Am Ende gerät ein solcher Umgang mit erinnerter Vergangenheit zu einer Vergegenwärtigung von Differenz, zum Gewahr werden, dass diese Zeiten ein für alle Mal vorbei sind.
Erinnern, Noch-Einmal-Denken und Wieder-Empfinden finden nun mal im jeweiligen Hier und Jetzt statt und lassen vor allem gegenwärtige Bewusstseinslagen und Maßstäbe dominieren. Wir haben es trotz vertraut erscheinender Empfindungen und rückwärts verweisender Eindrücke niemals wirklich mit einem Abtauchen in Vergangenheit zu tun, sondern mit einem mehr oder weniger kontrollierten Selbstversuch, welcher sich durchaus von einem „Zurück in die Kindheit“ unterscheidet und das Einräumen eines niemals zum Ziel gelangen Könnens zur Prämisse und zum Ergebnis hat.
Im Gewahr- und Bewusstwerden dieser Vergeblichkeit aber liegen zugleich die Grundlagen und Möglichkeiten zu einem ästhetischen Raisonnement, werden zusammen mit dem Gegenstand und Gegenüber unseres Interesses doch wie von selbst auch die eigenen, bisweilen uns selbst überraschenden Wahrnehmungsbewegungen nachvollziehbar.
Im Falle des Fotos des selbstversunken malenden Jungen sehe ich nicht allein das auf sein Tun konzentrierte Kind vor mir und vermag mich mit seiner Hilfe meiner eigenen Kindheit zu erinnern, sondern ich beginne auch wie von selbst mich als Wahrnehmenden wahrzunehmen und zu bedenken. Ich versetze mich ohne Mühe in die Lage, nicht nur das Bild vor mir, sondern zugleich die soeben gemachten Selbstbeobachtungen und Erfahrungen (also auch das Scheitern einer nahtlosen Anknüpfung an die Kindheit) an mir selbst zu machen und gleichzeitig zu reflektieren. Die Beschäftigung mit dem Foto des Jungen kann auf diese Weise zu einer Erkundung auch der Bedingungen und Möglichkeiten geraten, unter denen Vergangenes als zu Erinnerndes gegenwärtig wird.
Marcel Proust hat eine solche Vorgehensweise, die mit ihr verbundene Geisteshaltung und die daraus erwachsenen Chancen eines künstlerischen Umgangs damit in vorbildlicher Weise beschrieben. In seinem epochalen Roman „À la recherche du temps perdu“ii geht es eben nicht um einen historisch untersuchenden und vergewissernden Rückblick in die eigene Kindheit, sondern vor allem um die Möglichkeiten mittels erfühlter oder unwillkürlich empfundener Erinnerungsfragmente einen Zugang zu einer längst verloren geglaubten Welt zu erhalten.
Wir erinnern uns, dass das Schlüsselerlebnis des unwillentlichen Erinnerns (»mémoire involontaire«) bei Proust in der Lage war, Vergangenes im Bruchteil einer Sekunde plötzlich in unvermuteter Fülle und Totalität zu vergegenwärtigen. Auf Grund der sinnlichen Wucht und Wirkmächtigkeit dieses Erlebnisses (ausgelöst durch den Geschmack einer Madeleine), vermochte er seine Erinnerungen an eine längst vergangene kindliche Welt mit ihrer besonderen Atmosphäre und bestimmten an sich „unwichtigen“ Details zu Papier zu bringen und fortdauern zu lassen. Und indem diese Proust’sche Innenschau am Ende zu einem gelungenen Stück Literatur geriet, konnte sie vielen Lesern Möglichkeiten eigener Erfahrungen eröffnen und zum überpersönlichen Kunstwerk werden.
Überhaupt wäre „Er-innern“ in deutscher Sprache ein beinahe mehrdeutiges Wort, meint es doch nicht allein das wörtliche „nach Innen Holen“ vergangener Ereignisse, sondern auch das Aufgreifen innerer, anfänglich verborgener, verschütteter Gedanken, Vorstellungen, Bilder und Gefühle, welche im Erinnerungsakt aktiviert oder manchmal auch ganz neu formuliert werden.
Erinnerung ist also folgerichtig auch Neu-Kreation, Ein-Bildung, bisweilen Formung einer für gegenwärtige Gefühlslagen um- und neu interpretierten Vergangenheit. Sich an seine eigene Kindheit zu erinnern käme auch im Proustschen Sinne einem autopoetischen Vorgang gleich, einer Form von Selbstvergewisserung, die das, was einst war, neu schöpft und es zugleich auch zu einem Kriterium dessen werden lässt, was gegenwärtig ist.
Man könnte in diesem Sinne fragen, ob und inwieweit Erinnerungen, Vorstellungen, Träume, unerfüllte Wünsche, all’ die inneren Bilder und Ein-Bildungen, die wir im Grunde ständig mit uns herumtragen, sich als das Leben formende und prägende bemerkbar machen können. In welchem Maße also ausgewiesene Innenwelten derart vermittelt nach Außen zu dringen vermögen, dass wir nicht nur über sie zu reflektieren und zu sprechen beginnen, sondern sie schließlich im literarischen und künstlerischen Sinne Form werden lassen.
Manchem Pragmatiker mag eine solche Fragestellung abwegig vorkommen, scheinen doch hier Subjektivismus und Innenschau zum Maßstab gemacht zu werden. Doch geht es nicht um Abkehr von oder um Rückzug aus der Realität, sondern, wie das Beispiel Proust zeigt, um die Schaffung von geformten Tatsachen, um zielgerichtetes künstlerisches Handeln, das nach Außen drängt, sich aber besagtem Fundus innerer Bilder und unerfüllter Sehnsüchte verdankt.
Achim Bertenburg lotet, wie wir am konkreten Beispiel im Umgang mit dem Foto des malenden Sohnes nachvollziehen konnten, Möglichkeiten solcher subjektiven Verdichtungen und Übertragungen von Innenwelten nach außen in besonderer Weise aus. Im Idealfall sind für ihn Denken, Fühlen und künstlerisches Handeln nicht im Sinne glatter Schnitte voneinander zu trennen. Doch dies schließt Selbstbeobachtung und „ästhetische Distanz“ überhaupt nicht aus.
Wenn er Bilder malt, parallel dazu ein Boot baut oder seinen Sohn im Atelier beobachtet, ist er auch „sein eigener Phänomenologe“iv. Also einer, der das, was er gerade an Querverbindungen sieht, erlebt oder fühlt, zugleich untersucht und hinterfragt.
Das künstlerische Aktivieren und Ausloten solcher Innen- oder Zwischenwelten ist also kein bewusstloses Schwelgen in Vergangenheit, kein Abtauchen ins Irrationale, sondern eine besondere Methode der Selbstvergewisserung. Es ist die bewusste Einlassung auf in der Wirklichkeit angelegte, in ihr immer (mehr oder weniger latent) vorhandene Zwischenräume. Das reflektierte Aufgreifen von Erinnerungen, Vorstellungen, Träumen und Sehnsüchten, individueller, aber auch kollektiver Gedächtnissphären, ohne die Wirklichkeit als solche gar nicht komplett gedacht, erfahren und gelebt werden könnte.
Man könnte sogar behaupten, dass empirische oder materielle Realität sich erst zusammen mit den Bereichen des Imaginären, der Gedanken- Traum- und Gefühlswelt zum eingespielten System „Wirklichkeit“ aufaddiere. Erst unter Hinzuziehung der Vorstellungen, Bilder und Ideen, der Träume, Ängste und Sehnsüchte einschließlich ihrer Unschärfen und Übergänge kann sie in ihrer ganzen Komplexität und Dynamik begriffen werden.
Zur Dynamik einer so gedachten Wirklichkeit gehören auch Revisionen einmal gewonnener Standpunkte, natürlich auch das allmähliche Verblassen und Verschwimmen einst markant konturierter Erinnerungen und die Entstehung anderer neuerer, die an ihre Stelle treten. Erinnern, Zweifeln und Vergessen gehören zusammen und palimpsestartige Überlagerungen, Verdrängungen und Auslöschungen sind ineinander greifende Wirkkräfte innerhalb dieses Systems Wirklichkeit.
Wenn Wirklichkeit in dieser Weise als nicht in sich abgeschlossene, sondern als veränderbare, sich permanent ereignende verstanden werden darf, kann auch Gegenwart als „Station de Passage“, als zu verändernde auf einem weiter fortzusetzenden Weg begriffen werden. Denkt man sie zudem in Hinblick auf tradierte Bilder, Texte und berichtete Gefühlslagen als bereits Gewordene, kann sie schließlich als durch andere Subjekte bereits hindurchgegangene, schon von anderen einmal Gesehene, Erzählte und Gedachte verstanden werden. Auf diese offene Weise und nicht als in sich abgeschlossen kann Wirklichkeit auch intersubjektiv vermittelt und innerhalb ihrer viel gefächerten Beziehungsmuster weitergedacht werden.
Es geht hier nicht darum, markante Konturen wahrnehmbarer Wirklichkeit verschwimmen zu lassen, Unterschiede einzuebnen, gar einer (manchmal unterstellten) „Gleichgültigkeit“ das Wort zu reden, sondern im Gegenteil darum, Zusammenhänge und Wirkkräfte zwischen den einzelnen Sphären des Gegenwärtigen differenzierter wahrnehmbar werden zu lassen. Letztlich darum, Kunst und Literatur als „Experimentierfeld für unendlich viele Spiegelungen dessen, was wir Wirklichkeit nennen“v begreifbar werden zu lassen.
Achim Bertenburg trägt, so soll hier behauptet werden, einer derartigen Auffassung von Wirklichkeit insofern Rechnung, als er sich durch eine in ihr vorhandene Dynamik inspirieren lässt und ihr als Künstler entgegenkommt. Dies soll zunächst nicht an den Bildern, um die es auch und vor allem gehen soll, aufgezeigt werden, sondern an einer ganz praktischen, allerdings erst durch das Ausloten besagter Zwischenräume inspirierten und deshalb möglichen Entscheidung.
Es geht – das mag auf den ersten Blick verwundern - um den Bau eines Bootes, um das Selbst-Konstruieren eines aus Holz gemachten Gefährtes, mit dem man auf dem Wasser rudernd unterwegs sein kann. Wenn dieser Maler ein solches Boot tatsächlich parallel zur Arbeit an seinen Bildern beginnt und zu Ende baut, macht er dies nicht, weil ihm plötzlich in den Sinn gekommen wäre, neben der Malerei mal etwas ganz anderes zu machen, oder zur Abwechslung mit seinem Kind Boot zu fahren. Das Motiv und die Motivation zu dieser sicher nicht auf den ersten Blick „künstlerisch“ zu nennenden Entscheidung liegen tiefer.
Das, was zunächst konstruiert oder gar nicht zueinander passend erscheinen mag, lässt gewisse Querverbindungen zur Betrachtung des beschriebenen Fotos mit dem kleinen Jungen, am Ende aber auch zur Malerei und ihren Intentionen zu.
Beim Bau dieses Bootes geht es erstaunlicherweise um die Wiederaufnahme eines beinahe 50 Jahre alten Kindheitstraums. Die seinerzeit durch die Lektüre von J.F.Cooper, Mark Twain oder Jack London genährte romantische Vorstellung nämlich, mit einem selbstgebauten Boot den Fluss herunter zu fahren. Sie tauchte sicher nicht ganz zufällig, eher wie eine „mémoire involontaire“, eine Reminiszenz aus der eigenen Kindheit im Gedächtnis Bertenburgs wieder auf und führte zu einer pragmatischen Entscheidung.
In der Tat gab es in der Kindheit des Künstlers, wie bei vielen Zeitgenossen seiner Generation (auch beim Autor dieses Textes) Träume und Sehnsüchte, die schließlich angereichert durch Literatur oder Filme in Richtung einer Indianer- und Trapperromantik zu denken sind. Die von vielen Jungen seiner Generation geteilte Sehnsucht einmal „Indianer“ sein zu wollen orientierte sich nicht an der historischen Realität im Amerika des 18. und 19. Jahrhunderts. Es ging um kindliche Vorstellungen von Freiheit und Abenteuer, von Zeltromantik und Lagerfeuer, von einer im Zeitalter des Treckings und Extremsports eher harmlos erscheinenden Naturverbundenheit, wie sie von in den 1950er Jahren Geborenen noch ungebrochen und naiv geträumt werden konnte.vi Bertenburgs Entschluss ein Boot zu bauen geht also auf Bilder, Vorstellungen, Sehnsüchte zurück, die aus der eigenen Kindheit stammen, die er in Hinblick auf seinen eigenen Sohn ernst nimmt und in die Gegenwart transferiert – und hier gibt es in der Tat eine Verbindung zum anfangs beschriebenen Foto des malenden Jungen im Atelier.
Der Unterschied zwischen der Betrachtung eines Fotos und dem Bauen und Benutzen eines Bootes ist hingegen evident: Das Erste entspricht einem ästhetischen Raisonnement. Und bei Letzterem geht es nicht mehr um den Ausbau gedanklicher Welten, sondern um eine pragmatische Entscheidung, deren Richtung genau umgekehrt verläuft: Der Jungentraum wird vergegenwärtigt, reaktiviert und führt zum Entschluss, jetzt in Hinblick auf den eigenen Sohn in praktischer Hinsicht zu verwirklichen, was dem Vater seinerzeit als Kind verwehrt geblieben ist.
Der Entschluss des Erwachsenen, einen Kindertraum oder eine fast fünfzig Jahre zurückreichende Ein-Bildung umzusetzen und das darin imaginär vorhandene Boot wirklich zu bauen, geht indessen einher mit konkreter Planung, mit dem Kauf von Werkzeugen und Materialien und schließlich mit dem sicher für einen im Bootsbau Unerfahrenen nicht so einfachen „Machen“ selbst. Alles wird konkret, es hinterlässt sichtbare, materiell greifbare Resultate. Das Boot wird schließlich fahrtüchtig gemacht und bestiegen – die Reise findet statt.
Was aber hat das alles, wie oben unterstellt, mit Malerei, wie sie Bertenburg in den letzten Jahren verfolgt zu tun? Auf welche Weise könnte man zwei dem Genre nach so vollkommen unterschiedliche Bereiche zueinander in Beziehung setzen? Zunächst findet beides parallel zueinander statt. Das eine begleitet das andere, die Malerei wäre dann eine symbolische Komponente zum real konstruierten Wassergefährt. Doch diese Erklärung erscheint vielleicht zu einfach, sie entspräche der Annahme, dass jemand neben der Malerei als Ausgleich einem Kindertraum nachgeht und ein Boot baut und dass das eine mit dem anderen vielleicht doch nichts zu tun habe.
Nach einigen Überlegungen wird klar, dass auch das Boot für sich (selbst wenn es gar nicht in Betrieb genommen worden wäre) als Gebautes, letztlich Vorhandenes, Ausgestelltes oder Abgebildetes so etwas wie Unterwegssein, Reisen, von einem Ort zum anderen Gelangen wollen repräsentierten könnte. Man müsste es nur über seine pure Zweckdienlichkeit hinaus betrachten und könnte es dann als Metapher oder im Grunde leicht eingängiges Symbol für über es selbst hinausgehende Zusammenhänge begreifen.
Eva Schmidt hat einmal, als sich besagtes Boot noch im Bau befand, dafür den treffenden Begriff „Zeigeinstrument“ gefunden. vii Damals präsentierte Bertenburg in einer Ausstellung zusammen mit seiner Malerei tatsächlich auch das halbfertige Boot, was zugeben einige Besucher irritierte. Die Möglichkeit mit diesem Gefährt, wenn es denn einmal fertig würde, tatsächlich einmal unterwegs sein zu können, tauchte hier als zu bedenkende und zu empfindende und damit als Vorwegnahme einer später wirklich stattgefundenen Reise auf. Und die provozierendeviii Tatsache, dass das Boot, damals erst zur Hälfte fertig, wie eine Art Holzgerippe oder eine Baustelle inmitten von Malerei präsentiert wurde, verwies auf den transitorischen noch nicht zum Ende gelangten Charakter des ganzen Unterfangens, das in den parallel gezeigten Bildern sein spezielles, vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick zu entdeckendes Echo fand.
Bertenburgs Malerei als solche – blickt man auf ihre Ausformungen der letzten zehn Jahre zurück - hat so gesehen in der Tat eine große Affinität zum Thema des Unterwegsseins. Sie hat auch immer etwas Transitorisches, den Standpunkt Verlagerndes, was in der Tat jetzt noch zu erläutern wäre.
Auf den ersten Blick sind es meist monochrom angelegte Flächen, die man wahrnimmt - mit nebel- oder schlierenartige Strukturen darin. Bei intensiverer Betrachtung aber meint man Andeutungen von Formationen zu entdecken, Schatten oder im Farbnebel sich verflüchtigende Konturen von Gegenständen, Landschaftsaspekten oder Wolkenformationen.
Die meisten dieser von vornherein „unscharf“ angelegten Bilder erschweren jede Art der Fokussierung. Man möchte mit den Augen tiefer ins malerische Dickicht vordringen, möchte den vermeintlichen Gegenstand hervorholen, optisch „scharf stellen“, deutlicher konturieren, und identifizieren, was sich da verbirgt und muss feststellen, dass diese Bilder von vornherein gerade auf eine solche nicht zum Ende gelangende Wahrnehmungsbewegung hin angelegt sind. Sie rechnen mit einem Betrachter, der immer wieder der Versuchung erliegt, hier ein Abbild der Welt, wie er sie kennt „wieder“ zu entdecken, um am Ende doch einzugestehen, dass es eben diese Sehnsucht (oder unstillbare Seh-Sucht) ist, die hier auf besondere Weise thematisiert wird. Sie rechnen also auch damit, dass ein Betrachter im Akt des Betrachtens seinen Standpunkt (und damit potentiell auch sich selbst) in mehrfachem Sinne ändert.
Er, der Betrachter findet in der Tat zunächst einen Teil seiner Bemühungen, sich gewohnheitsgemäß ein Bild der Welt zu machen, ein solches gleichsam in sich entstehen, zur Ein-Bildung gelangen zu lassen – und damit auch einen Teil seiner kulturellen Prägung – wieder. In dieser Hinsicht greift Achim Bertenburg auf Traditionen von Malerei zurück, wie sie seit der Renaissance bestehen, ein zutreffendes Bild der Welt als Abbild zu vergegenwärtigen oder gar als identisch mit ihr zu suggerieren.
Einige der neuen Bilder erinnern in ihrer formalen wie farblichen Organisation an traditionelle Landschaftsmalerei, glaubt man doch innerhalb der verschwommenen malerischen Textur Anzeichen von Flussläufen, Uferböschungen, Baumsilhouetten oder Wolkenformationen zu entdecken. Doch wird dieser Eindruck nie zur Gewissheit, weil schließlich immer das Gemachte, der Pinselduktus und die sich überlagernden ineinander übergehenden eher vieldeutigen Farbgebilde sich als die eigentlichen Motive dieser Bilder erweisen.
Man erkennt schließlich, dass die vermeintlichen im Bild vorhandenen oder als Andeutungen repräsentierten Gegenstände sich in dem Maße dem Betrachterauge entziehen, indem es Anstalten macht sie zu fixieren oder zu identifizieren - bis man schließlich begreift, dass man es mit malerisch angelegten „Entzugserscheinungen“ zu tun hat. Das Erkennen-Wollen von Seiten des Betrachters und das Sich immer wieder Entziehen auf Seiten des Bildes halten sich dabei die Waage und führen schließlich in eine nicht enden wollende Pendelbewegung, die charakteristisch für die malerische Auffassung von Bertenburg und zugleich für die besondere Art ist, sich seinen Bildern anzunähern.
Wenn es einen Inhalt oder eine Botschaft in dieser Malerei gibt, dann ist es ihre Fähigkeit unsere anscheinend nicht zu unterdrückende Sehnsucht, in ihnen etwas (wieder-) erkennen zu wollen, herauszufordern und bewusst zu machen. So gesehen geht es Bertenburg neben der Lust am Bild (wer wollte diesen Werken ihre Sinnlichkeit absprechen?) auch um eine in ihnen eben in dieser ästhetischen Pendelbewegung formulierte Repräsentationskritik: Einerseits reflektiert er nicht nur die besagte Angewiesenheit jedes Wissens auf Vorstellungen und Bilder und die Tatsache, dass es unmöglich ist, der Repräsentation und damit auch den Bildern ganz zu entfliehen. Andererseits postuliert er innerhalb seiner Entzugs- oder Verweigerungsstrategien einen anderen, sagen wir kritischen, zweifelnden und verantwortlicheren Umgang mit Bildern. Für sich gesehen sind die zum Teil großformatigen Gemälde bravouröse Malerei. Lasierende, zum Teil auch in sich bewegte Farbverläufe, Wechsel von luftigen, transparenten Schichtungen zu opaken pigmentgesättigten Verdichtungen hellerer und dunklerer Bildzonen.
Eine zuoberst liegende auf den ersten Blick etwa grau erscheinende Farbschicht vermag zwar die darunter liegenden Schichten zu überlagern, jedoch wegen ihrer Transparenz nicht gleich zuzudecken, so dass auf einmal tiefer liegende rötliche oder grünliche Abtönungen wie durch einen Schleier hindurch an die Oberfläche gelangen oder besser „scheinen“ können. Grau als Mischung der beiden „Nichtfarben“ Weiß und Schwarz vermag auf diese Weise eine Affinität zur bunten Farbskala der Grund- und Komplementärfarben zu erhalten. Übereinander liegende Lasuren vermögen zudem noch ein Raumgefühl zu suggerieren, das man von gemalten Wolkenformationen älterer Meister, aber von den raumbildenden Oberflächen der Farbfeldmalerei der 1960er und 70er Jahre her kennt. Solche Bildzonen lassen unseren Blick in vermeintliche Tiefen eintauchen, obwohl wir doch genau wissen, dass es sich bei dem, was wir faktisch vor uns sehen, nur um hauchdünne Farbschichten auf einer von sich aus ohnehin raumindifferenten zweidimensionalen Bildfläche handelt.
Es lohnt sich also durchaus bei der Betrachtung der Bertenburg’schen Bilder mehrmals die Position zu wechseln, immer wieder abwechselnd von vorn, von der Seite aus zu schauen, aus der Distanz und dann wieder ganz aus der Nähe, um gerade solche Farb- und Raumphänomene und die mit ihnen verbundenen koloristischen Feinheiten zu entdecken. Lässt man sich auf eine derartige Erkundungsreise ein und nimmt sich dabei auch etwas Zeit, kann man wie von selbst die Möglichkeiten von Malerei, wie sie dieser Künstler auch am Anfang des 21. Jahrhunderts (im reflektierten Bezug zur Kunstgeschichte) ganz ernsthaft meint und praktiziert, erfahren.
Ein erwiesenermaßen reines Farbphänomen, ein Schatten oder Nebel ohne jeden Gegenstandsbezug versetzen uns immer wieder in die Lage in unserem Kopf Vorstellungen, innere Bilder, Erinnerungen - etwa an Landschaften, oder im weitesten Sinne an „Natur“ entstehen zu lassen oder auszulösen. Dass gemalte Bilder in unserer Kultur hoch entwickelter Bild- und Medientechnologien noch immer „etwas“ repräsentieren, auf etwas außerhalb ihrer selbst verweisen sollen, gehört vielleicht zu den kulturbildenden Anachronismen des Medienzeitalters. Und Bertenburg nimmt in seiner Arbeit diesen für ihn konstruktiven Widerspruch auf, verwandelt ihn in eine Bildenergie.
Und dann ist da noch eine die soeben beschriebene ästhetische Erfahrung variierende durchaus auch etwas irritierende malerische Komponente, die ebenfalls zu diesen Bildern gehört: Es sind eben nicht nur die schemenhaft sich andeutenden und dann doch wieder sich entziehenden Formen, sondern da gibt es auch scheinbar aus einer spontanen, freien Bewegung des Pinsels heraus entstandene Linien und Pinselschläge, die für nichts als sich selbst stehen. Fast sähe man sich geneigt von „Gesten“, „Chiffren“ oder „Notationen“ mit einem gewissen „Ausdruck“ zu sprechen, wenn man nicht wüsste, dass Bertenburg den alt gedienten Kategorien der „Unmittelbarkeit“, „Spontaneität“ oder gar „Expressivität“ als Grundlage für zeitgenössische Malerei eher skeptisch gegenüber steht. Diese Tugenden gehören allenfalls zu den Diskursen einer vor etwa einem halben Jahrhundert ihren Anspruch auf Selbstverwirklichung, Lösung und Heil artikulierenden Moderne.
Und doch tauchen als Elemente in einigen Bildern Bertenburgs auf einmal Striche, Bögen oder breitere Farbbänder auf, die anscheinend keinem imaginierten Bildraum, keinem angedeuteten Gegenstandsbezug mehr, sondern nur noch sich selbst verpflichtet sind. Allenfalls bilden sie Entsprechungen zum Duktus der malenden Hand, wuchern aber auch zwischen mehreren eher unscharf-flächig angelegten Farbzentren im Bild wie bei einem Netzgeflecht hin und her, oder sie verbinden die einzelnen Fokusse eines Bildes wie Rhizome untereinander. Jedenfalls zeugen sie vom konkreten Einsatz malerischer Mittel, wollen auch nach längerer Betrachtung nichts anders sein als sie selbst: in Bewegung aufgetragene Farbbahnen und Linien.
Manchmal werden aber auch diese rein „abstrakten“ Elemente besagten Unschärfen unterworfen und die Klarheit ihres Verlaufes auf einer andersfarbig kontrastierenden Grundfläche scheint sich allmählich wie in Nebel aufzulösen. So als mache eine präzise gesetzte Chiffre Anstalten, sich in den Illusionsraum einer wiederum im Bild imaginierten dritten Dimension zu verflüchtigen. Lässt man sich mehr auf dieses Mit- und Nebeneinader disparater Elemente ein, gewinnt man den Eindruck, als
habe Bertenburg während des Malaktes auf einer „abstrakteren“ Ebene in Gedanken, die schließlich in Pinselstriche überzugehen vermochten, das Bild noch einmal „übermalt“, - so wie man einen angedachten Gedanken noch mal überdenkt oder einen Text noch mal liest, um ihn noch besser zu verstehen und ihn anschließend doch noch einmal zu überschreiben.
In der Tat gibt es in mehreren Bildern regelrechte palimpsestartige Überlagerungen, Überschreibungen einer eher räumlich-suggestiven Auffassung von Malerei durch den Einsatz beschriebener „abstrakter“, nur für sich stehender Elemente, ohne dass das eine das andere auslöscht oder in den Hintergrund drängt: Beides ist immer gleichzeitig da und kann auch vom Betrachter selbst als Spur noch oder als Nachhall seiner selbst identifiziert werden.
Der Prozess der Überschreibung, die besagten Überlagerungen, Durchdringungen und Durchmischungen disparater Bildauffassungen zeugen indessen auch von einem immer wieder vollzogenen Standpunktwechsel des Malers vor der Leinwand, und von einer bei ihm permanent stattfindenden gegenseitigen Durchdringung von Denken und Fühlen, von Planung und Intuition, von Zufall und Kontrolle. Sehen, Denken, Erinnern, Imaginieren und schließlich das sprichwörtliche Malen sind eins.
Der Verlauf einer Linie, das Wachsen einer Form und die differenzierte Abtönung eines Farbfeldes, sind nicht im Nachhinein erfolgte Illustrationen vorher gefasster Entscheidungen. Diese malerischen Komponenten sind Entscheidungsträger und damit auch Erkenntnisformen an sich, denen es an Präzision nicht mangelt. Und sie entwickeln und verändern sich während ihres Zustandekommens.
Empirische Realität und Bereiche des Symbolischen und Imaginären begegnen, berühren und durchdringen sich während des Malaktes, der sich am Ende als spezifische Erkenntnisform und Verstehensweise begreifen lässt. Eine dermaßen „denkende“, über sich selbst (hinaus) reflektierende Malerei gerät in der Praxis natürlich immer zu einem Balanceakt, dessen ständige subtile Korrektur und vorsichtige Umgewichtung Programm ist und deshalb auch immer wieder riskiert werden muss. Es liegt angesichts dieser Deckungsgleichheit nahe, hier wieder an den kleinen Jungen am Ateliertisch des Vaters zu denken, bei dem die sprichwörtliche Nähe von Kopf, Auge und Hand einer solchen Einheit von Beobachten, Denken und Machen Ausdruck verleiht.
Wenn anfangs immer wieder von Erinnerungen, Ein-Bildungen, Gedanken- und Gefühlswelten in Hinblick auf Wirklichkeit die Rede war, so kann jetzt behauptet werden, dass solche Komponenten in den Bildern Bertenburgs ihre malerischen Äquivalente finden. Man könnte sogar davon sprechen, dass die in einem denkenden Malprozess sich gegenseitig aufaddierenden, zum Teil auch relativierenden und gegenseitig zudeckenden Bildvorstellungen ein überaus komplexes und der oben entworfenen Vorstellung von Wirklichkeit adäquates Beziehungsmuster ergeben.
Und doch gibt es in dieser Malerei keine Anarchie, keine simple Anhäufung disparater Elemente, die irgendwie durcheinander wirbeln oder gegeneinander antreten. Kennzeichnend für die Bilder ist ein für sie typisches Miteinander innerbildlicher Stabilität und einer gleichzeitig vorhandenen Dynamik, welche einerseits den Standpunktwechsel des Malers zur Grundlage hat, andererseits denjenigen des Betrachters – auch im wörtlich zu nehmenden Sinne – immer wieder herausfordert.
Und noch ein anderes Wesensmerkmal fällt nach einer gewissen Beschäftigung mit und vor diesen Bildern auf. Bertenburg geht nicht von fertigen, mediatisierten und veräußerten Bildern aus, wie es manche dem Fotorealismus verpflichtete Maler tun. Sein Anliegen ist es auch nicht, die kulturelle Indienstnahme und den mit ihr verbundenen Verschleiß von Bildern und ihren Botschaften zu beschreiben oder gar zu kritisieren. Ihn interessiert vielmehr die Frage, wie Bilder entstehen und wie sie ihre spezifische imaginative Kraft entfalten.
Wenn, wie es immer wieder passiert, wir vor seiner Malerei stehen und glauben, in einer verschwommen gemalten Textur ansatzweise etwas angedeutet zu finden, dessen eindeutige Referenz am Ende doch wieder verweigert wird, eröffnet dies eine in diesen Bildern angelegte Möglichkeit und Chance ästhetischer Erfahrung, der wir -
gerade in Hinblick auf den beschriebenen Standpunktwechsel - nachgehen sollten.
Beginnen wir nämlich zusammen mit der Malerei auch die eigenen Wahrnehmungen zu reflektieren, bemerken wir, dass wir permanent dabei sind, ein Bild in unserem Kopf entstehen, es gleichsam darin zur Ein-Bildung gelangen zu lassen. Wir greifen dabei auf bereits vorhandene Bilder aus unserem Gedächtnis zurück, fangen an sie auf das, was wir da gemalt vor uns sehen, zu beziehen oder direkt zu übertragen. Zugleich erkennen wir, dass es dieses Bild, das da gerade in unserem Kopf entsteht ja noch gar nicht gibt, dass es erst durch unsere Hilfe „wird“. Und dass es letztlich auch diesem Maler darum geht, in seiner Arbeit ein solches aus vielen Komponenten sich zusammensetzendes Werden, Zustandekommen, „Ein-Bilden“ anschaulich werden zu lassen.
Katalogtext Ausstellung Weserburg / Museum für moderne Kunst, 2011